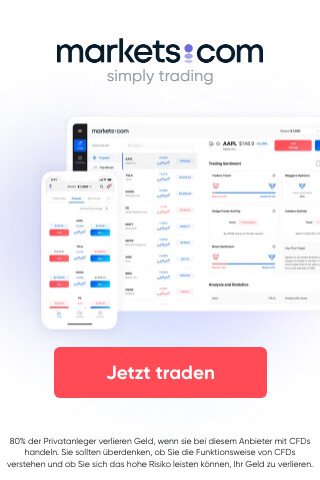Mehr als 100.000 Armenier sind nach der militärischen Niederlage gegen Erzfeind Aserbaidschan aus Berg-Karabach.
01.10.2023 - 12:52:38«Wir haben alles verloren»: Flüchtlingsdrama in Armenien. Nun wissen viele von ihnen, weder wohin sie gehen können, noch, was sie tun sollen.
Der Kulturpalast in Goris ist für viele Flüchtlinge aus Berg-Karabach die erste Anlaufstation. In der Kleinstadt 15 Kilometer von der Grenze zu Aserbaidschan entfernt ist eilig ein Auffanglager aufgebaut worden. Im Kulturpalast werden die Ankömmlinge registriert, wenn nötig medizinisch behandelt und dann weiterverteilt. Nachts verwandelt sich das Foyer in einen riesigen Schlafsaal.
Vor dem Gebäude herrscht ein nicht weniger geschäftiges Treiben. Ein Bus sammelt Flüchtlinge Richtung Ostarmenien ein. Daneben fährt eine Familie im eigenen Pkw los. Der alte graue Toyota ist vollgepackt bis über die Heckscheibe. Auf den Dachgepäckträger hat die Familie eine Schrankwand gelegt, und darauf hat sie dann das Hab und Gut, das sich in Säcke verpacken ließ, aufgeschnürt. Auf den steilen Serpentinen des armenischen Südkaukasus sind an diesem sonnigen Herbsttag Tausende solcher Fuhren unterwegs.
Währenddessen bieten Freiwillige vor den aufgebauten Zelten verschiedener Hilfsorganisationen Wasser und warmes Essen an. An einer Stelle liegen alte Kleider wild durcheinander geworfen auf dem Boden. Margarita, eine ältere Frau, sucht darin etwas für ihre Enkelkinder aus. «Mir ist das fürchterlich peinlich. Ich wühle nicht in Sachen herum», sagt sie. Aber sie hätten alles zurücklassen müssen bei ihrer überstürzten Flucht. Margarita ist mit ihrer Mutter, ihrer Tochter und deren Ehemann sowie sieben Enkelkindern nach einer strapaziösen mehrtägigen Fahrt angekommen.
Kritik an Armeniens Regierungschef Paschinjan
«Ich musste schon das zweite Mal fliehen», erzählt die 60-Jährige. Als Aserbaidschan 2020 nach heftigen Gefechten Berg-Karabach zum Teil zurückerobern konnte, musste sie ihr erstes Haus verlassen. Nun, da Baku sich gewaltsam die ganze Region wieder einverleibt hat, ist Margaritas Familie zum zweiten Mal obdachlos geworden. «Wir wurden verkauft», zürnt sie Armeniens Führung um Regierungschef Nikol Paschinjan. Statt sich zu wehren, habe man kampflos aufgegeben. Proteste in Eriwan belegen, dass viele Armenier auch so denken.
Margarita, die einst als Chemikerin im Bergbau arbeitete, hat in den 1990er Jahren selbst gekämpft. Damals hat sich die in Aserbaidschan liegende, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region in einem blutigen Bürgerkrieg von Baku gelöst. Doch nun sieht sie keine Chance mehr, in ihre Heimat zurückzukehren. «Ich hoffe einfach nur, dass meine Enkel sich hier zurechtfinden», sagt sie. Der zehnjährige Tigran neben ihr sei ein guter Schachspieler, sagt sie stolz. «Ganz wie sein Namensvetter». Der armenischstämmige Tigran Petrosjan war in den 1960er Jahren Schachweltmeister.
Schach ist auch die Leidenschaft von Geworg. Der 28-jährige war in Gerger Lehrer für Physik und Schach. «Dort hat schon der Großvater meines Großvaters gewohnt», erzählt er. Sein Vater sei 2020 im Krieg getötet worden. Also hat er nun seine Mutter, seine Ehefrau, die Schwester und den minderjährigen Bruder aufgeladen und ist auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Er wolle nach Masis, einer Stadt auf der armenischen Seite des türkischen Bergs Ararat. Dort hätten sie zumindest schon eine Wohnung. Der Rest müsse sich finden.
Kein Vertrauen in Aserbaidschan
Warum er nicht geblieben sei, wo Baku den Karabach-Armeniern doch Sicherheit zugesagt hat? Weil er nicht an die Versprechungen glaube. «Das wiederholt sich schon doch seit mehr als 100 Jahren, seit dem Massaker von 1915», erinnert Geworg an den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich, bei dem bis zu 1,5 Millionen Menschen umgekommen sind. Die Türkei, deren Präsident Tayyip Recep Erdogan immer wieder mit der Auferstehung des Osmanischen Reichs flirtet, steht im Konflikt zwischen Baku und Eriwan fest an der Seite der turksprachigen Aserbaidschaner.
Die Geschichte zwischen Armeniern und Aserbaidschanern ist ebenfalls voller Blut. Mit Pogromen und gegenseitiger Vertreibung. Dass Baku trotz Waffenstillstand dann vor zwei Wochen zum Sturm Berg-Karabachs ansetzte, nachdem es vorher die Region monatelang von der Außenwelt abgeschnitten und damit eine humanitäre Katastrophe provoziert hatte, lässt die Armenier auch an Bakus Versprechen zweifeln. Und so hat sich Geworgs Familie vier Tage lang durch den Stau von Berg-Karabach und durch den Latschin-Korridor nach Armenien gequält. In der Kleinstadt Vayk, wo ein weiteres Auffanglager aufgebaut wurde, haben sie sich mit Wasser und Lebensmitteln für die Weiterfahrt versorgt.
100.000 Menschen sind innerhalb weniger Tage aus Berg-Karabach geflüchtet. Offiziell wurde die Gesamtzahl der Bevölkerung vor einigen Jahren mit 120.000 angegeben, aber die Zahl sank stetig.
Zwischen Koffern und Plastiksäcken auf der Straße
Vayk etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt Eriwan entfernt, kommt mit der Vielzahl der Flüchtlingen sichtlich schlechter zurecht als Goris. Die Kleinstadt mit normalerweise nur 5000 Einwohnern ist mit dem Andrang überfordert. Viele der Hilfesuchenden sitzen zwischen ihren Koffern und Plastiksäcken auf der Straße. Edward, ein 47 Jahre alter Arbeiter, zeigt auf seine dick geschwollenen Beine. «Sie sind so abgenutzt wie alte Reifen», sagt er nach der langen Busfahrt aus der Hauptstadt Berg-Karabachs, Stepanakert.
Paschinjan hat den Flüchtlingen für das nächste Halbjahr Hilfen von 250 Dollar monatlich zugesagt. Aber wie in Goris sind auch in Vayk vor allem freiwillige Helfer im Einsatz, um die Not zu lindern. Etwa ein halbes Dutzend Verpflegungszelte sind aufgebaut. «Gestern waren allein in unserem Zelt 2000 Menschen, davon 600 Kinder», erzählt Karen. Mit anderen Freiwilligen einer kirchlichen Hilfsorganisation gibt er belegte Brote, Gemüse, aber auch warmes Mittagessen aus. Für die Kinder werde Zuckerwatte gemacht, um die Stimmung etwas aufzuhellen. «Fast alle Ankömmlinge sind niedergeschlagen und traurig. Für Wut fehlt den meisten die Kraft», sagt der 47-Jährige.
«Wir haben alles verloren»
Diesen Eindruck kann Schasmin nur bestätigen. «Ich fühle eine Leere und tiefes Bedauern», sagt die 68-Jährige. «Wir haben alles verloren». Sie sei in Baku geboren, musste dort als Armenierin aber 1988 infolge ethnischer Unruhen fliehen - mit drei kleinen Töchtern. «Zwei meiner Töchter leben jetzt im ukrainischen Charkiw unter Bomben» während sie, ihr Mann und ihre dritte Tochter in Stepanakert nun zum zweiten Mal ihr Heim verloren hätten.
Drei Tage lang hat sie auf der Straße gesessen und auf den Bus gewartet, der die Familie aus der Stadt bringen sollte. Nun wurde ihr angeboten, eine Bleibe in einem abgelegenen Dorf zu beziehen. Doch Schasmin kann sich nicht zu diesem Schritt durchringen. «Ich habe immer in der Stadt gelebt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mich in meinem Alter noch umzustellen und ganz von vorn anzufangen», sagt sie mutlos.